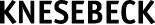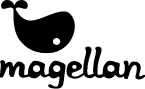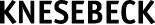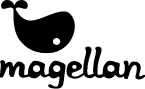vierzehn tage: ein gemeinschaft ...
charlie jane anders, margaret atwood, jennine capo crucet, pat cummings, joseph cassara, angie cruz, sylvia day, emma donoghue, dave eggers, diana gabaldon, tess gerritsen, john grisham, maria hinojosa, mira jacob, erica jong, cj lyons, celeste ng, tommy orange, mary pope osborne, douglas preston, alice randall, caroline randall, ishmael reed, roxana robinson, nelly rosario, james shapiro, hampton sides, r.l. stine, nafissa thompson-spires, monique truong, scott turow, luis alberto urrea, rachel vail, weike wang, deshawn charles winslow, meg wolitzer
2024